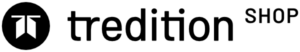Projektion erkennen
Projektion erkennen / Definition
Projektion ist ein psychologischer Abwehrmechanismus und eine weit verbreitete menschliche Bewältigungsstrategie.
Wir projizieren mit dem Ziel, uns vor dem bewusst werden von Gefühlen, Impulsen und Eigenschaften zu schützen, die wir in uns tragen und bisher erfolgreich verdrängt haben. >> Projektion erkennen und nutzen
Unbewusst übertragen wir sie auf unser Gegenüber. D.h.:
Durch Projektion schreiben wir den Ursprung unangenehmer innerer Wahrnehmungen einem anderen Menschen zu.
Wir könnten z.B. annehmen, dass jemand wütend auf uns ist oder uns kontrollieren will und uns dessen nicht bewusst sein, dass das die Emotionen und Bestrebungen sind, die wir gerade selbst gegenüber dieser Person empfinden.
Bis zu einem gewissen Grad projiziert jeder von uns ab und zu.Das schöne ist:
Wenn du deine Projektionen als solche erkennst, kannst du an ihnen wachsen und die Qualität deiner Beziehungen wird davon enorm profitieren.
Eine Externalisierung entsteht ähnlich, wie die Projektion. Hier geben wir anderen für unsere Probleme die Schuld und umgehen die Notwendigkeit, Verantwortung für unseren Anteil am Geschehen zu übernehmen.
Aber der Preis für die bequeme Opferrolle ist hoch:
Wir verzichten nicht nur auf die Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die jeweilige Situation zu nehmen.
Der Lerneffekt bleibt aus und die Verdrängung der daraus resultierenden Schuldgefühle kostet viel Energie.
Die Art deiner Bewältigungsstrategien und die Häufigkeit der Anwendung ist Ausdruck des Grads deiner emotionalen Reife.
Projektion ist ein kindlicher Abwehrmechanismus. Sie führt zu einem reaktiven Umgang mit Konflikten, ohne Rücksicht auf langfristige Konsequenzen.
Das Ignorieren oder Verzerren der Realität dient als Schutz vor Ängsten, um weiter zu funktionieren.
Dieses Abwehrverhalten wird von Kindern sehr oft benutzt. Man kann also davon ausgehen, dass Menschen, die stark zur Projektion ihrer Schwächen auf andere neigen und sich dessen nicht bewusst sind, Defizite in ihrer emotionalen Entwicklung aufweisen.
Der Grund dafür liegt wiederum im mangelnden Reifegrad der Bezugspersonen, denen sie in der kindlichen Prägungsphase ausgesetzt waren.
Projektion erkennen / gesunde Grenzen
Eine emotional reife Mutter mit einem stabilen Selbstwertgefühl ist dazu in der Lage ihr Baby auch dann zu lieben, wenn es ihr Schmerz zufügt.
Wenn ihr Kind sie beim Stillen in die Brust beisst, wird sie nicht wütend werden und abweisend reagieren, weil sie dem Kind keine Boshaftigkeit unterstellt.
Eine in sich selbst unsichere Mutter mit diffusen Grenzen wird in Situationen, die ihr Unwohlsein bereiten dazu neigen ärgerlich und abweisend zu reagieren. Aber ein Baby fühlt sich noch eins mit seiner Mutter. Es hat sehr durchlässige Grenzen und verinnerlicht ihre Reaktionen:
Die Art, wie eine Mutter ihrem Kind begegnet ist für das Kind ein Spiegel seines Werts und seiner Liebenswürdigkeit.
Wenn es schroff behandelt wird fühlt es sich nur bedingt geliebt, weil es spürt, dass es Aspekte in sich trägt, die nicht okay sind.
Und so wächst es mit Überzeugungen über sich selbst auf, die auf Schamgefühlen („Ich bin nicht okay.“) basieren.
Es wird später als Erwachsener anfällig für Manipulation und Mißbrauch sein (siehe Ängstlich überinvolviertes Bindungsverhalten ) oder es wird unbewusst selbst zum Täter werden (siehe Abweisend vermeidendes Bindungsverhalten )
Wenn Eltern ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle bewusst oder unbewusst an erste Stelle setzen verinnerlichen ihre Kinder aufgrund des diffusen Gefühls, zu viel und gleichzeitig zu wenig zu sein die Überzeugung, dass ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten keine Bedeutung haben.
Sie werden später in ihren Beziehungen zu ängstlichem, co-abhängigem Verhalten neigen.
Projektion erkennen / Selbstverurteilung
Wenn wir chronische Schamgefühle in uns tragen verurteilen wir uns unbewusst selbst. Wir haben einen starken inneren Kritiker – eine innere Stimme, die uns als Mensch abwertet und unsere Handlungen, Fähigkeiten, Eigenschaften oder unser äußeres Erscheinungsbild in Frage stellt.
Da all das meist unterbewusst passiert, kommt auch in diesem Zusammenhang die Abwehr durch Projektion zum tragen und die intern ablaufende Selbstkritik wird durch Projektion nach außen gebracht:
Du könntest z.B. auf banale Meinungsverschiedenheiten heftig reagieren und dich angegriffen fühlen. Das Geschehnis im Außen hat dann deine Selbstkritik im Inneren aktiviert.
Wenn du chronische Schamgefühle in dir trägst wirst du Situationen oft falsch interpretieren und annehmen, dass andere dich ablehnen, verurteilen oder ignorieren.
Und es ist dir vielleicht gar nicht bewusst, dass du dir selbst oft gedanklich mit Ablehnung, Verurteilung und Ignoranz begegnest.
Im Heilungsprozess lernst du dich selbst wieder anzunehmen und wertzuschätzen. Dann wirst du dich spürbar wohler im Umgang mit anderen Menschen fühlen.
Projektion erkennen / Fehlende Abwehr
Von einer toxischen Beziehung sprechen wir, wenn ein Partner chronischen emotionalen Schmerz erduldet und die eigenen Bedürfnisse zugunsten des Gegenübers vernachlässigt (siehe Toxische Beziehung heilen )
Menschen mit ängstlich überinvolviertem Bindungsverhalten tendieren zu dieser Art von Selbstaufopferung, um Konflikte mit ihrem Partner zu vermeiden.
Letztlich geht es ihnen dabei darum, ihre grösste Angst (die Angst, verlassen bzw. abgelehnt zu werden) im erträglichen Rahmen zu halten.
Dadurch kommt die Beziehung in eine fatale Schieflage. Es entsteht ein Machtgefälle, durch das der ängstliche Partner mehr und mehr an Autonomie und Selbsteffizienz verliert.
Wenn das Gegenüber vermeidende bzw. narzisstische Verhaltensmuster zeigt, dann entwickelt sich ein unaufhaltsamer Abwärtstrend.
Das distanzierte, unzuverlässige Verhalten des einen verstärkt das unterwürfige, bedürftige Verhalten des anderen („Ich muss mich noch mehr anstrengen, um geliebt zu werden.“).
Ängstlich überinvolvierte Bindungstypen werden aufgrund ihrer starken Selbstzweifel zur idealen Leinwand für die Projektion von Schamgefühlen, die – wie bei ihnen selbst – auch bei ihren vermeidenden Partnern, eine ins Unterbewusstsein verdrängte Ursache des unsicheren Bindungsverhaltens sind.
Co-abhängige Bindungstypen mit starken Verlustängsten nehmen die Projektionen eines autonomer handelnden Gegenübers in der Regel an.
Sie versuchen sich noch besser anzupassen und noch verständnisvoller zu sein. Es fällt ihnen unsagbar schwer, loszulassen und den Kampf um Anerkennung und ein Gefühl von Verbundenheit aufzugeben.
Obwohl sie ihren Partner vielleicht schon mit Samthandschuhen anfassen werden sie die Angst vor seiner Ablehnung nicht los.
Ein Gefühl von absoluter Wertlosigkeit ist die Folge. Sie glauben, nichts besseres verdient zu haben.
Projektion erkennen / Projektive Identifikation
Ein Mensch mit gutem Selbstwert kann gesunde Grenzen setzen. Die Projektion von Schwächen auf ihn wird deshalb nicht gelingen:
Sie prallt ab, weil er keine Zweifel daran hat, dass das Gesprochene nicht der Realität entspricht und letztlich nur etwas über den Redner selbst vermittelt.
Ein Mensch mit schwachem Selbstwert hat dagegen seine sensiblen Themen:
Wenn er sich mit ihnen konfrontiert sieht ist er besonders anfällig dafür, eine Projektion als Tatsache anzunehmen. Er stimmt ihr – wenn auch oft unbewusst – im Innersten zu.
Das führt dazu, dass die Projektion förmlich an ihm klebt. Er kann sie nicht abweisen.
Wenn er auf die Beschämung seines Partners durch Projektion auch noch mit Rechtfertigung reagiert, gibt er seiner Vorstellung bzw. Meinung über ihn mehr oder weniger Recht.
Der abweisende Partner gewinnt so noch mehr Autorität und Kontrolle.
Er bekommt die subtile Botschaft, einen großen Einfluss auf den Selbstwert seines Gegenübers zu haben.
Projektion erkennen / Antworten
Menschen mit schlechter Grenzsetzung und starkem Außenfokus sind anfällig dafür, die Projektionen anderer anzunehmen.
Sie neigen dazu, das Gesagte als eigene Eigenschaft anzunehmen.
Um dich besser schützen zu können ist es (neben dem Aufbau eines gesunden Selbstwerts) wichtig zu verstehen, wie projektive Identifikation funktioniert.
Die Projektion deines Gegenübers (die Abwehr seiner eigenen Gefühle und Schwächen) zu erkennen ist natürlich Gold wert, denn sie ist eine Art Fenster in sein Unterbewusstsein.
Du kannst in diesem Moment tatsächlich beobachten, was dein Gegenüber denkt und fühlt.
Wenn du von einem Menschen verbal angegriffen wirst, dann ist das eine Reaktion auf seine inneren unbewussten negativen Gefühle und Konflikte.
Durch den Aufbau deines Selbstwerts entwaffnest du deinen inneren Kritiker. Das ist der beste Schutz vor Projektion.
Wenn du erkennst, dass ein Mensch gerade etwas auf dich projiziert ist es wichtig eine Grenze zu setzen, die die Projektion auf den Sprecher zurück wirft.
Du kannst dazu Sätze, wie diese verwenden:
- „Das sehe ich anders.“
- „Ich stimme nicht zu.“
- „Dafür übernehme ich keine Verantwortung.“
- „Das ist deine Meinung.“
Lasse dich bitte nicht zu Argumenten verleiten. Versuche nicht, dich zu verteidigen.
Es würde der verzerrten Realität des Projizierenden nur Glaubwürdigkeit verleihen.
Besteht er trotzdem weiter auf dem Gesagten, dann antworte am besten mit so etwas, wie: „Wir sind da unterschiedlicher Meinung.“
Das Gespräch solltest du damit besser beenden. Der Projizierende wird so auf seine eigenen Gefühle zurückgeworfen und hat zumindest eine Chance, seine Projektion zu erkennen.
Projektion erkennen / Umgang
Das, was wir in unserer Umgebung wahrnehmen sagt tatsächlich mehr über uns selbst, als über die Welt da draußen aus.
Wenn wir es schaffen, unsere eigenen Projektionen aufzudecken, dann wachsen wir daran enorm:
Wir werden stärker, autonomer, flexibler und toleranter. Und wir lernen, anderen Menschen mit Aufmerksamkeit statt Reaktivität zu begegnen.
Es gibt Hilfsmittel, um die eigenen Projektionen zu entlarven. Wenn du dich dabei ertappst andere zu beurteilen, dann kannst du dir diese Fragen stellen:
→ Was hat das eigentlich mit mir zu tun?
→ Werfe ich meinem Gegenüber gerade vor, was ich selbst in mir trage?
→ Werfe ich meinem Gegenüber etwas vor, was ich mir selbst nicht erlaube?
→ Werfe ich meinem Gegenüber vor etwas zu haben bzw. zu können, was ich nicht habe bzw. nicht kann?
Eine weitere Möglichkeit ist, die eigene Urteile niederzuschreiben und sie umzuformulieren:
Aus „Er/sie ist …“ wird so „Ich bin …“.
Schaue dir den neuen Satz an und frage dich:
→ Bin ich auch so? Kann/will ich es nur nicht sehen?
→ Sollte ich vielleicht etwas mehr von dieser Eigenschaft haben/leben?
Auf diese Weise kommst du dir und deinen Schatten auf die Spur. Es ist eine Chance, deine blinden Flecken zu entdecken.
Dir diese Fragen zu stellen und sie ehrlich zu beantworten braucht Mut. Aber du kannst sicher sein, dass er reichlich belohnt wird:
Wenn deine emotionale Kompetenz wächst wirst du merken, dass der Umgang mit anderen Menschen friedlicher und gelassener wird.
Deine Beziehungen verlieren immer mehr ihr Konfliktpotenzial.
Wenn du tiefer einsteigen willst kannst du das mit Hilfe meines Buches „Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben“. Oder du kontaktierst mich zur Vereinbarung eines Einschätzungsgesprächs.
Das Buch ist auch im tredition SHOP erhältlich (lieferbar)